Aus der Ferne

Iurii lebt seit acht Jahren in der Schweiz, liebt die Berge und mag seinen Job als Projektingenieur. Mit einer Push-Nachricht am 24. Februar 2022 holt ihn die Heimat ein. Durch den Krieg in der Ukraine stellt sich für ihn die Frage des Ankommens in der Ferne erneut. Über mehrere Wochen habe ich Iurii in seinem Leben in der Schweiz begleitet. Im vergangenen Herbst war ich in Zürich, wo er wohnt und arbeitet, zu Besuch und in Chur war ich bei einem Treffen mit einer Freundin von ihm aus der Ukraine dabei. Daraus entstanden ist eine Reportage, die zeigt, dass der Krieg in der Ukraine, der am 24. Februar schon ein Jahr dauert, auch Iurii in der Schweiz zu grundlegenden Überlegungen zwingt.
Wallisellen
Chur
Dübendorf
Wallisellen
Wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, will Iurii Burda mir etwas zeigen. Wir spazieren durch Wallisellen, durch das Wohnen in der Industrie, und gehen den Hügel vom Bahnhof hoch Richtung Kirche. Um uns Hochhäuser und Einfamilienhäuschen. Iurii blickt immer wieder skeptisch nach oben. So, als ob er dem Himmel nicht ganz traut. Er bleibt stehen, als ihm eine Katze mit einem weissen Fleckauf der Brust um die Beine streicht. «Hallo du Schöne. Trägst du eine Krawatte?», sagt der 31-Jährige zum Büsi. Mit einer Hand streichelt er durch das schwarze Fell, mit der anderen checkt er die Meteoapp auf seinem Handy. Er zeigt mir den Regenradar. «Der Regen kommt doch», kommentiert er. Folglich kehren wir um und gehen die Strasse wieder hinab. «In Wallisellen ist in den letzten acht Jahren viel gebaut worden. Daran erkenne ich, wie lange ich schon hier bin.» Eigentlich wollte Iurii mir einen seiner liebsten Orte hier zeigen. Vom Hügel hinter der Kirche kann man die Berge sehen.
Wir sprechen über die Churfirsten. «Als ich damals in der Schweiz ankam, war ich von dieser einen Strasse, die dem Walensee entlangführt, sehr beeindruckt. Die hohen Berge, der klare See. Das war einfach wow.» Die Berge sind Iuriis Passion. Wenn er darüber spricht, sagt er «passion» – englisch betont. «Es gibt auch Berge in der Ukraine. Der höchste ist 2061 Meter hoch. In der Schweiz ist das wohl eher ein kleiner Hügel», meint er und grinst. Er kommt von dort, wo die Karpaten sind. «Schon als Kind ging ich mit meiner Familie immer eher in die Berge als ans Meer.» Fast wieder beim Bahnhof angekommen, geht Iurii voraus in ein kleines Einkaufszentrum. «Gömmer is ‘Fleischli’», meint er. Ein Café mit allerlei Süssem und Salzigem in der Auslage. Iurii bestellt zwei heisse «Schoggi» und wir setzen uns an einen kleinen Tisch am Fenster, durch das man das Treiben im feierabendlichen Zentrum beobachten kann. «Es tut mir leid, wenn ich Fehler mache. Wenn mir jemand zu Schulzeiten gesagt hätte, dass ich in einem deutschsprachigen Land für längere Zeit leben würde, hätte ich diese Person für verrückt gehalten.» Um seine Augen bilden sich kleine Fältchen. Dann lacht er. Es ist im ganzen Raum hörbar.
1991 wird die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig. Im selben Jahr wird Iurii geboren. Er wächst im Westen der Ukraine auf. In Iwano-Frankiwsk, einer Stadt mit rund 250’000 Einwohner:innen, 600 Kilometer von Kyjiw entfernt. «Für die Ukraine ist das eine kleine Stadt.» Er erzählt, dass er immer in dieser Stadt war. Seine ganze Familie komme von dort. Die Eltern wohnen immer noch in der Stadt, die Schwester ist Anfang September 2022 in die USA ausgewandert. Als Kind wollte Iurii Lastwagenfahrer werden. Geworden ist er schlussendlich Maschinenbauingenieur. «Irgendwie hat mein Kindheitstraum ja auch etwas mit Engineering zu tun. Bei Lastwagen geht andauernd etwas kaputt, dass man reparieren muss.» Er erzählt, dass schon seit Vater Ingenieur war. Und sich, nachdem die Tochter wenig Interesse für Technik zeigte, sehr gefreut habe, seine Leidenschaft mit dem Sohn zu teilen. «Eigentlich hatte ich keine andere Wahl.» In Iwano-Frankiwsk geht Iurii in die Schule. Später studiert er an der technischen Uni in seiner Stadt Maschinenbau.
Iurii nimmt einen Schluck des Heissgetränks in seiner Tasse. Ein weisser Schnauz bleibt als Zeuge. Belustigt streicht sich der junge Mann den Milchschaum von der Oberlippe. Iurii wirkt oft, als bewege er sich zwischen zwei Welten. Zwischen der Schweiz und der Ukraine. Zwischen Iurii, dem Wissenschaftler und Iurii, dem Empath. Zwischen Angepasstheit und Kritik. Dass er den Krieg in seinem Heimatland aus der Ferne beobachten muss, macht ihm zu schaffen. Und doch bekommt die Ukraine durch die Tragik wieder mehr Platz in Iuriis Herzen. In seinem Innern war das Land lange umarmt zwischen Nähe und Distanz.
Im Rahmen seines Studiums macht er an der Empa, der eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf, ein Praktikum. Es ist nach Leoben und Bochum sein dritter Auslandaufenthalt. Erst in der Schweiz lernt Iurii Deutsch. «Es war einfacher mit den Technikern an der Empa, wenn ich ihre Sprache verstand.» Im Hochschulumfeld davor kam er mit Englisch durch. Heute spricht Iurii gut Hochdeutsch, ein Akzent ist geblieben. Nur bei ausgewählten Worten traut er sich ans Schweizerdeutsch. Im Allgemeinen sei Deutsch eine sehr systematische Sprache, wie «Mathi». «Wenn du eine Gleichung kennst, dann kannst du die verschiedenen Koeffizienten einsetzen. So kann man auch Sätze und Wörter betrachten. Trotzdem braucht es eine gewisse Struktur, damit die Sprache funktioniert. Sie ist nicht so frei wie Englisch oder Ukrainisch.» Wie im Westen der Ukraine üblich, ist Iuriis erste Sprache Ukrainisch und nicht Russisch. «Ich spreche dennoch fliessend russisch, und das, obwohl ich nie in meinem Leben Russisch-Unterricht hatte», sagt er und wird kritisch. «Russland war schon immer sehr nah. Meiner Meinung nach zu nah. Es gab viel zu viel Russisches in unserer Kultur. Eine kulturelle Invasion, nicht nur durch die Sprache. Der kulturelle Markt in der Ukraine ist begrenzt und wurde jahrelang durch russische Produkte dominiert. Auch, weil das finanzielle Potential Russlands immer schon sehr viel grösser war. Das wird zwar als Soft Power verstanden, ist aber sehr aggressiv.» Es braucht Zeit, bis Iurii das versteht. Als Junge und auch als Jugendlicher macht er sich noch keine Gedanken über den Länder- und zu einem Teil auch Generationenkonflikt. «Kinder wie ich sind mit der Idee aufgewachsen, dass die Ukraine ein unabhängiges Land ist. Und mit der Vorstellung, dass die Sowjetunion nichts Gutes war.»

Nach dem Praktikum in der Schweiz geht Iurii zurück in die Ukraine. «Ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl. Es war, als ob alle darauf warteten, dass etwas passiert.» Genauer kann er es nicht benennen. Damals nicht und heute genau so wenig. Er sagt, dass er nie gedacht hätte, dass es zum Krieg kommt. Bis Anfang 2014 beteiligt sich Iurii an den Maidan-Protesten in seiner Heimatstadt. «Wie viele andere war ich nicht einverstanden mit der Entscheidung unserer Regierung gegen die EU. Und ich bin der Meinung, dass Protest ein wichtiges Kommunikationsmittel ist.» In Iwano-Frankiwsk sind die Proteste friedlich. Iurii telefoniert regelmässig mit seiner Cousine, die in der Hauptstadt wohnt. Von ihr bekommt er die Informationen aus erster Hand, die damals auch in der Schweiz für Schlagzeilen sorgen. «Im Februar 2014 wurden etwa 100 Leute in Kyjiw erschossen. Das konnte ich nicht glauben», erzählt er am kleinen Tisch im «Fleischli». Seit der Annexion der Krim läuft es auf einen Krieg hinaus. Iurii meint, dass zu diesem Zeitpunkt die Masken der Russen gefallen seien. Dass die Ukrainer:innen, die Russland als Brüder und Schwestern bezeichnete, eigentlich schon ab da zum Angriffsziel wurden. Iurii wirkt, als müsse er sich die Situation immer wieder vor Augen halten. Auch heute gibt es noch viele Momente, in denen er all die Entwicklungen nicht so recht glauben kann.
Dennoch tritt Iurii kurz nach den tödlichen Schüssen in Kyjiw eine befristete Anstellung an der Empa an und verlegt seinen Lebensmittelpunkt in die Schweiz. Er ist damals einer von wenigen. Rund 6000 Ukrainer:innen leben 2014 in der Schweiz. Acht Jahre später werden es mehr als zehnmal so viele sein. In der Ukraine folgen derweil weitere Eskalationen. Russland beginnt den Krieg im Donbass und annektiert die Krim. In der Ukraine wird eine Zwischenregierung eingesetzt. Für Iuriis Empfinden ging das alles sehr schnell. «Die Grenze war plötzlich nicht mehr dort, wie ich das in der Schule gelernt hatte.» Die weiteren Jahre vergehen und es wird – vermeintlich – ruhiger in der Ukraine. Iurii lebt in der helvetischen Parallelwelt. Er konzentriert sich auf sein Ankommen in der Schweiz und schiebt die Gedanken an sein Heimatland ein bisschen zur Seite. An den Wahlen 2019 beteiligt er sich nicht. «Ich war kein Fan von Selenskyj, die anderen Kandidat:innen waren jedoch auch keine Alternativen für mich», erklärt er. Heute sei er froh, dass Selenskyj Präsident wurde. «Er steht für die Ukraine ein und verteidigt unsere Werte.»
Im Dezember 2021 kommt wieder ein ungutes Gefühl in Iurii auf. Er verfolgt, was Putin im Fernsehen sagt. Und das beunruhigt ihn. Der Krieg beginnt am 24. Februar 2022. «An einem Donnerstag», präzisiert Iurii. «Als ich damals aufwachte, habe ich sofort mein Handy in die Hand genommen. Auf dem Bildschirm musste ich lesen, dass der Flughafen meiner Stadt mit Raketen bombardiert wurde. Ich wollte das nicht glauben.» Seither fehlte Iurii nur wenige Tage bei der Arbeit. Nicht, weil er keine Ferien hätte, sondern weil ihn Schuldgefühle plagen. «Wenn ich Spass habe, fühlt es sich für mich so an, als würde ich meine Freundinnen und Freunde, die in der Ukraine kämpfen, im Stich lassen.» Es ist schwierig, auch nach einem Jahr Krieg. Iurii weiss auswendig, wie viele Tage genau seit diesem einen Donnerstag vergangen sind, der sein Leben so grundsätzlich erschütterte. Er ist seither an sein Handy gefesselt. Will keine Meldung verpassen. Telefoniert mit der Familie. Tauscht Whatsapp-Nachrichten mit Freundinnen und Freunden aus. «Ich kann mich kaum abgrenzen.» Einen Grossteil seiner freien Zeit verbringt er an dem kleinen Bildschirm. «Seit dem Krieg habe ich mich vieles gefragt. Auch, ob das, was ich hier mache, sinnvoll ist. Wozu zum Beispiel Werkstoffcharakterisierungen? Was bringt das?»
Mit dem Krieg macht sich Iurii auch zum ersten Mal Sorgen um seine Eltern. Zuvor hatte er sie bloss vermisst. «Sie waren 1500 Kilometer weit weg von mir. Das war bis dahin meine Realität.» Aber an diesem 24. Februar und auch danach hätte er seine Familie am liebsten bei sich gehabt. «Ich habe ihnen gesagt, dass sie zu mir in die Schweiz kommen sollen. Aber sie wollten nicht. Ihr ganzes Leben ist dort in der Ukraine. Ihr Haus, ihr Garten, ihr Heim. Es war nicht einfach für mich, das zu akzeptieren.» Iurii bleibt ohne seine Eltern in der Schweiz. Sie wollen nicht fort. Im Gegenteil. Sie schaffen sich einen jungen Hund an. Ihr Sohn lacht in Wallisellen darüber. «Vielleicht könnte man denken, dass das dumm ist. Im Krieg einen Hund aufzunehmen. Aber es tut ihnen gut, in dieser Zeit etwas zu haben, das Freude ausstrahlt. Diese Leichtigkeit gibt ihnen Hoffnung.» Seine Schwester ist nach Kriegsbeginn in die USA ausgewandert. «Ihr Partner lebt schon länger dort. Sie hat sich schon vor dem Krieg dazu entschieden, ihm zu folgen. Aber als der Krieg ausbrach, war sie plötzlich nicht mehr sicher, ob es richtig ist, zu gehen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, dass ich hier in der Schweiz, in Sicherheit, bin, während andere geblieben sind und unser Land verteidigen.»
In Iuriis Augen liegt jetzt Trauer. Hier in der Schweiz hat er Perspektiven. Einen guten Job. In der Ukraine müsste er sein Leben wieder komplett neu aufbauen. «2017 habe ich in Lenzburg eine Ausstellung besucht. Sie hiess ‘Heimat’.» Wo ist Heimat? Dort, wo du geboren bist? Dort, wo du aufgewachsen bist? Dort, wo deine Eltern sind? Dort, wo du deine erste Liebe getroffen hast? Oder dort, wo jemand von deiner Familie gestorben ist? Iurii schaut mich an. «Für dich ist das vielleicht klar. Aber für mich ist es das nicht. Hier in Zürich weiss ich, wann ich den ÖV wegen den Stosszeiten meiden sollte. Und ich kann von hier bis nach Genf ohne Navi fahren. In der Ukraine weiss ich nicht, wann die meisten Leute unterwegs sind. Ausserdem kenne ich den Weg von meiner Stadt bis nach Kyjiw nicht auswendig. Siehst du? Ich bin im Moment auf der Suche nach meinem Zuhause. Die Ukraine ist und bleibt aber sicher meine Heimat.» Ob die Schweiz das je sein wird, weiss Iurii nicht. Dafür sei es noch zu früh. Nach kurzer Überlegung: «Durch den Krieg fühle ich mich viel mehr als Ukrainer als je zuvor in meinem Leben. Aber wenn die Gefahr besteht, dass du etwas verlieren könntest, was ein Teil von dir ist, tut das weh.» Er kommentiert sich selbst: «Das ist kontraintuitiv.»
Iuriis Heimatstadt: Iwano-Frankiwsk
Mit der Pushmeldung auf dem Handy am 24. Februar 2022 ändert sich auch Iuriis Leben von einem auf den anderen Tag. Bis dahin arbeitet er viel. Daneben hat kaum etwas Platz. Ab und zu fährt er Velo, baut sich sogar eines. Oder er trifft sich mit Freundinnen und Freunden. In den letzten acht Jahren hat Iurii sich einen multikulturellen Freundeskreis in der Schweiz aufgebaut, darunter auch einige Ukrainer:innen. Ein befreundetes Paar lebt in Landquart. Durch sie kommt Iurii zur Ukrainehilfe Graubünden und engagiert sich freiwillig. «Vor ein paar Tagen wurden Heizzentralen bombadiert, die Ukrainer:innen brauchen warme Sachen.» Iurii erzählt, dass er sehr beeindruckt ist von der Hilfsbereitschaft der Schweizer:innen. «Das berührt mich. Und manchmal bringt es mich auch zum Lachen. Einmal brachte jemand Skier, ein anderer einen Racletteofen».
Im März, rund ein halbes Jahr vor unserem Treffen im «Fleischli», kamen die ersten Ukrainer:innen als Flüchtende in die Schweiz. Eine Freundin von Iurii arbeitet in leitender Funktion bei Kinderkrebs Schweiz. Die Organisation holt Familien mit krebskranken Kindern aus der Ukraine. Iurii bietet sprachliche Unterstützung und – so gut er kann – auch moralische. «Ich wusste immer, dass der Krieg für viele Menschen noch viel ernster war, ist und sein wird als für mich. Das muss man sich mal vorstellen: Du kommst in ein neues Land, hast ein Kind, dem es nicht gut geht und du weisst, dass du nichts mehr hast, wenn du zurückkehrst.» Für ihn sei das die erste Volunteering-Erfahrung gewesen, noch vor seinem Engagement bei der Ukrainehilfe Graubünden. Und zu sehen, wie viele seiner Landsleute ihre Heimat verlassen mussten, trifft ihn. «Ich meine, es ist ja schon nicht fair, dass Kinder Krebs bekommen. Wenn dann noch keine vernünftige Behandlung möglich ist, weil Raketen einschlagen…», sagt er und bricht im Satz ab.
In diesem Rahmen begegnet Iurii auch Olha und Oleksandra, «Sasha» genannt. Eine Mutter und ihre krebskranke Tochter. Die beiden kommen in Chur bei einer Gastfamilie unter. Schnell entsteht aus Volunteering Freundschaft. Und Iurii, der die Alpenstadt nur schon wegen den Bergen so mag, besucht die zwei seit ihrem Kennenlernen regelmässig. So auch ein paar Tage nach unserem Gespräch in Wallisellen. An diesem sonnigen Herbsttag parkiert Iurii seinen Mazda vor einem Mehrfamilienhaus mit begrünter Fassade. «Ich vergesse immer, in welcher Wohnung sie wohnen», meint er. In der Folge zückt er sein Handy, sagt etwas Kurzes auf Ukrainisch und dann an mich gewannt: «Sie kommt». Nur wenig später erscheint eine zierliche Frau in den 40ern mit braunen, schulterlangen Haaren im ersten der Hauseingänge. Sie und Iurii begrüssen sich mit einer herzlichen Umarmung. Mir streckt Olha die Hand hin. Iurii hilft bei der Verständigung und übersetzt vom Ukrainischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Ukrainische. Olhas Tochter geht es nicht gut, weshalb sie sich unserem Spaziergang nicht anschliesst. An Olha gewandt meint Iurii: «Du bist jetzt Churerin. Wohin gehen wir?» Die Angesprochene lacht und tätschelt ihm kollegial auf den Oberarm. Es sei überall schön hier. Besonders jetzt, wo sich der Herbst in den buntesten Farben zeige, meint sie. Am Calanda, dem Bergmassiv, das Chur über dem Rhein abgrenzt, trennt das farbige Laub der Bäume oben von unten.
Während dem Gehen unterhalten sich Iurii und Olha. Schon bald werden Olha und ihre 14-jährige Tochter in die Ukraine zurückreisen. Dies, sobald die letzten Untersuchungen in der Schweiz abgeschlossen sind. Beide haben grosses Heimweh. Olha musste ihren Mann und die ältere Tochter zurücklassen. Sie ist nur geflüchtet, weil Sasha die Therapie gegen den Krebs brauchte. Abgesehen vom Rest der Familie vermisst Olha vor allem ihre Arbeit. Wir kommen an einem Kran vorbei. Sie zeigt darauf. «Ich arbeite in der Ukraine an den Hebekränen in einer Stahlgiesserei. Im Moment habe ich unbezahlten Urlaub. So lange weg von der Arbeit war ich noch nie. Und immer, wenn ich hier einen Kran sehe, freue ich mich», sagt Olha. «Das kann ich gut verstehen», meint Iurii, der Ingenieur. Beide lachen.
Im Fontanapark, einem grünen Fleck nahe der Altstadt, setzen sich Iurii und Olha auf eine Bank. Olha nimmt ihr Handy aus der Handtasche und scrollt zwischen Fotos auf einer Facebook-Seite hin und her. Zerstörte Häuser, zerbombte Wohnungen, kaputte Strassen. Viel grauer Staub. «Das ist, was geblieben ist. Die Bilder haben Bekannte von Olha, die im selben Ort wohnen wie ihre Familie, erst kürzlich hochgeladen», erklärt Iurii. Er wendet sich an Olha und scheint, sie etwas zu fragen. Die Ukrainerin schüttelt den Kopf. «Ich wollte wissen, ob es in der Nähe Militärinfrastruktur, Industrie oder Elektrizitätswerke hat. Sie hat gesagt, dass es am Rande der Stadt nur Einfamilienhäuser gibt. Das passiert nicht zufällig. Das macht Russland mit Absicht», sagt Iurii. Olhas Augen füllen sich mit Tränen.
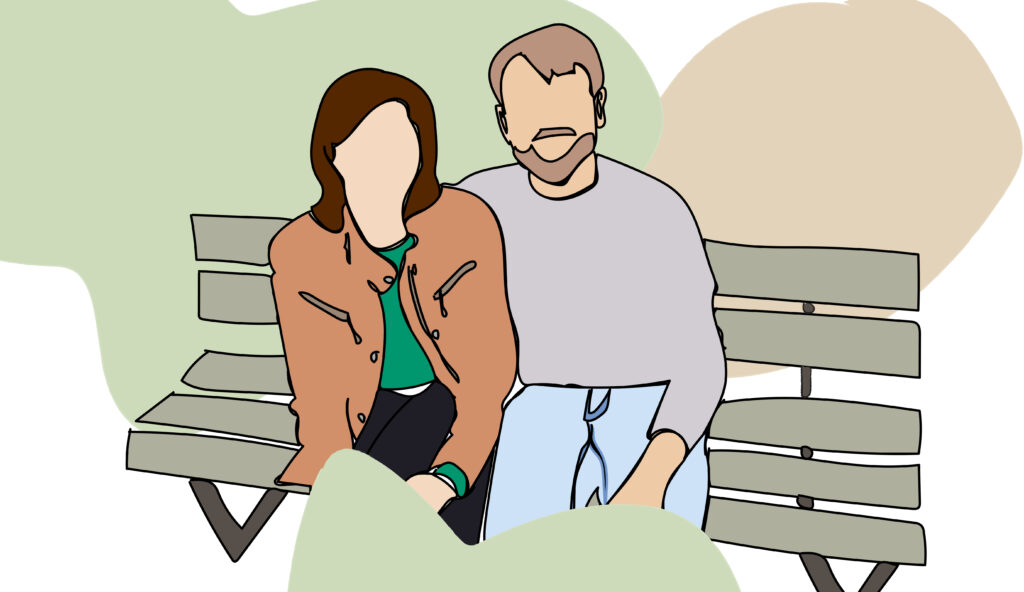
Sie war mit Sasha im Spital, als der Krieg ausbrach. Die Sirenen haben ihr Angst gemacht. Und die Bilder aus der Ukraine tun es immer noch. Sie erzählt schnell und nimmt sich kaum Zeit, um Luft zu holen. Irgendetwas, was wie «Stress» klingt, verstehe auch ich. Sie tupft sich mit einem Taschentuch über die Wangen. Iurii rückt ein Stück näher an seine Freundin heran und schaut sie mit grossen Augen an. Als wolle er all ihre Gefühle aufnehmen, sodass seine eigenen keinen Platz mehr haben. «Ehm», meint Iurii und macht dann wieder eine Pause. «Das letzte Jahr war sehr schwierig für Olha.» Er übersetzt: Im Januar hat Olha erfahren, dass ihre Tochter krank ist. Dann kam der Krieg und sie musste die Ukraine verlassen. Auch die Tatsache, dass die beiden allein in einem fremden Land sind, hat sie gestresst. Seit Mai besucht sie einen Psychotherapeuten. Er kommt aus Belarus und die beiden können russisch miteinander reden. Es ist sehr wichtig, dass die Kommunikation ohne Übersetzung funktioniert. Olha sagt, dass sie sich machtlos fühlte. «Mittlerweile kann ich mich ein bisschen besser abgrenzen.» Heute begleitet die grosse Freude über das baldige Wiedersehen die Angst.
Nach dem Spaziergang will auch Olha Gastgeberin sein und bittet auf eine Tasse Kaffee. Iurii ist zwar auf dem Sprung, möchte Sasha aber noch sein Geschenk überreichen. «Ich bringe ihr immer etwas mit, das mit Technik zu tun hat. Das letzte Mal hat sie daraus Tiere gebastelt.» Aus dem Kofferraum seines Mazdas holt er ein Experimentierset für Seifenedelsteine. Solche Kristalle haben zumindest ihn als Kind fasziniert. Sasha kommt aus einem der Zimmer. Sie ist blass und dünn. Aber schon viel weniger, wie als Iurii sie kennenlernte. Er umarmt das Mädchen vorsichtig und flüstert ihr etwas zu. Olha setzt derweil das Wasser auf.
Die Wohnung ist modern. Ein Industrieloft mit viel Beton. Auf dem Sideboard neben dem grossen Küchentisch stehen Bilderrahmen, die glückliche Momente konservieren. Wir sprechen über Berufe. Olha erzählt, dass sich Sasha nun bald entscheiden müsse, was sie werden will. Alltägliches Küchentisch-Hin-und-Her entsteht. Olha bedankt sich nach dem Geplauder für die Gespräche. Iurii schliesst sich ihr an. Dann schweigen beide. In diesem Moment nimmt sich der Gedanke Raum, dass sie sich nicht mehr oft wiedersehen werden. Sie sprechen darüber, wie es weiter geht. Sashas letzte Untersuchung steht bevor. Danach müssen sie schauen, wie man das Bankkonto in der Schweiz auflöst. Solche Dinge. Und dann müssen sie sich informieren, wie sie zurückkommen. Wahrscheinlich über Berlin. Zum Abschied umarmt Iurii Sasha behutsam und Olha lange.
«Mir war von Anfang an klar, dass sie nicht bleiben», sagt Iurii im Auto. Anders als Olha und Sasha sei er nicht geflüchtet, sondern in etwas Neuem angekommen. Und das Neue gefällt Iurii gut. Die Natur, die Arbeit und auch die Menschen in der Schweiz. Trotzdem ist da auch Sehnsucht und Wehmut in seinem Herzen. «Ich liebe mein Land mehr, als ich dachte. Am meisten fehlt mir der ukrainische Humor», sagt Iurii. Humor hilft, auch in Krisenzeiten. «Wenn man über sie lachen kann, dann sind die Russen bei weitem nicht so furchteinflössend, wie sie gern wären.
Dübendorf
An einem der letzten warmen Tage dieses ereignisreichen Jahres ist auf dem Gelände der Empa in Dübendorf viel los. Iurii kommt mit seinem leicht schrägen Gang auf mich zu. Am Empfang holt er einen Besucherbadge ab. Er zeigt auf eine Plakette, die die Empa als gute Arbeitgeberin auszeichnet. «Das stimmt», meint Iurii. «Gömmer?», fragt er und führt durch das Areal, das sich wie ein Labyrinth aus Gebäuden und Gängen, Treppen und technischen Anlagen, Lichtern und Laboren präsentiert. Ob er sich hier noch nie verlaufen habe, will ich wissen. Iurii schüttelt den Kopf. Er habe sich schnell orientieren können. Die Empa ist für ihn ein wichtiger Ort. Seine Arbeit führte ihn in die Schweiz und ist auch der Grund, warum er noch immer hier ist. Iurii geht voraus, von einer Maschinenhalle in die nächste. Er erklärt die Anlagen und Apparaturen, in den Augen ein Technik-Strahlen, dass sich mir schwer erschliesst. Er öffnet einen Raum im Keller. Der Badge piepst und die Tür macht komische Geräusche. «Hier machen wir Materialanalysen. Im Moment bin ich an einem Ermüdungsversuch für Metall, das in einem Flugzeug eingesetzt wird. Vielleicht ist das mit dem Müdesein ja eine Berufserkrankung. Nach über 30 Jahren auf der Welt weiss ich noch immer nicht, wie man sich richtig erholt.» Iurii nimmt eine Metallprobe, die Nummer 37, und spannt sie in die Maschine ein. Während er das tut, erklärt er die Versuchsanordnung penibel genau. Das technische Vokabular kommt ihm leicht von den Lippen.
Besonders Schadenanalytik interessiert Iurii. Darüber spricht er gerne. Über anderes schweigt er lieber. Was hat sich seit Kriegsausbruch verändert? «Ich war schon ambitionierter. Aber der Krieg hat mich gezwungen, mein Leben zu reevaluieren. Es ist kurz und der Beruf nicht alles. Für mich war das aber für eine sehr lange Zeit so. Ich war ein echter Workaholic.» Iurii berichtet von vielen Wochenenden, die er freiwillig an der Empa verbrachte. «Ich hatte ja nichts anderes zu tun.» Er zuckt mit den Schultern. Vieles, was ihm früher wichtig war, sei jetzt sehr viel weniger relevant. Er hatte eine längere Reise geplant. Nach Australien, Neuseeland und dann noch nach Amerika. «Vor Covid wusste ich, wie man reist. Danach habe ich es vergessen. Und jetzt würde es sich falsch anfühlen.» Dennoch ist er in der Schweiz oft unterwegs. Iurii erzählt von Orten, die ihn beeindruckten und von Wanderungen, die ihn an seine Grenzen brachten. Er öffnet Google Maps auf seinem Handy. Die Fläche der Schweiz ist bedeckt mit Fähnchen und Herzen. Orten, an denen er schon war, oder noch hinwill.
Im Büro nebenan ist leises Telefonieren zu hören. Ich frage Iurii, ob er sich hier aufgehoben fühlt. Er schaut mich an, im Gesicht Fragezeichen. «Was heisst das?» Er merke manchmal, dass die Menschen Mühe hätten, ihn auf den Krieg anzusprechen. Dabei wünscht er sich, dass man genau das tut. Als die Stimme im Nebenzimmer verstummt, geht er ins Büro, das er sich mit seinem Chef teilt. Christian begrüsst in breitem Berndeutsch. Er erzählt, dass er und sein Team am Anfang tatsächlich nicht genau wussten, wie sie mit Iurii in der schwierigen Situation umgehen sollten. «Er war häufig absorbiert, manchmal sehr emotional und manchmal sehr verschlossen.» Iurii hat sich an den Besprechungstisch gelehnt und nickt. «Es ist schwierig.»
Im Gang trifft er auf viele Menschen. Die meisten grüsst er mit Vornamen. Eine Frau mit einer kurzen Bob-Frisur und einer Brille, die ihr tief auf der Nase sitzt, stellt er mir in einem der Labore vor. «Das ist Tetiana, sie ist auch Ukrainerin.» Sofort wechselt er auf Englisch. Die Frau, die etwa im gleichen Alter wie er ist, zeigt ihm etwas Glänzendes unter dem Mikroskop. «You see?», fragt sie. Iurii runzelt die Stirn. «Wir machen gemeinsam einen Versuch, bei dem es um die Korrosion von Aluminium geht. Wir haben beide noch nie mit diesem Material gearbeitet. Bis jetzt haben wir noch keinen Fortschritt erzielt. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht mit einem schnellen Erfolg gerechnet.»

Tetiana hat einen Doktortitel in Festkörperphysik und ist seit August an der Empa. «Seit dem 2. August. Du bist auf den Tag genau zehn Jahre nach mir an die Empa gekommen», sagt Iurii an die Wissenschaftlerin
gewandt. Sie lacht und nickt. «Stimmt, am 1. August läuft in der Schweiz nichts. Da kann man nicht gut ankommen.» Wir wechseln den Standort. Zwei Treppen runter, im Kaffeeraum, steht fast immer ein Kuchen auf dem Tisch. Die Frau eines Mitarbeitenden backe leidenschaftlich gern, erklären Tetiana und Iurii. Sie nimmt sich eine grosse, weisse Tasse aus dem Hochschrank, er setzt sich schon an den Tisch. Von der heutigen süssen Überraschung sind nur noch «Brösmeli» auf einer goldenen Platte übrig. Tetiana gesellt sich zu Iurii, dampfender Kaffee in der Tasse. Die beiden unterhalten sich. Über Aluminium und schnell auch über den Krieg.
«Wir haben eine besondere Verbindung, weil wir aus dem gleichen Land kommen. Wir teilen Geschichten und Traditionen. Vieles müssen wir einander nicht erklären», sagt Iurii. Tetiana nickt. Ihr habe es sehr geholfen, dass Iurii ebenfalls aus der Ukraine stammt und dass er ihre Gefühle und Konflikte besser verstehe als andere. Sie ist nach Kriegsausbruch zusammen mit ihrem Bruder und dessen Familie geflüchtet. Vier Tage verbrachten sie an der Grenze zu Rumänien. Sie habe kaum geschlafen in dieser Zeit. Dann die Erlösung in Deutschland. Für fünf Monate bleibt Tetiana mit ihrer Familie da. Online bewirbt sie sich für einen Job an der Empa. «Es war meine erste Bewerbung und ich bin dankbar, dass es gleich geklappt hat.» Einmal habe sie ein Typ gefragt, ob die Situation in der Ukraine tatsächlich so schlimm sei, wie er das in den Zeitungen sehe und lese, erzählt Tetiana. Iurii wirft ein, dass man bestimmt gar nicht alles zeigen dürfe. Sie habe dem Mann dann gesagt, dass es tatsächlich noch viel schlimmer sei. Er antwortete, dass es ihm immer wie in einem Film vorkomme. Tetiana hebt den Blick. «Wenn du Familie und Freund:innen, besonders tote Freund:innen, in der Ukraine hast, dann ist der Krieg real.» Sie wendet sich in Ukrainisch an Iurii. Er sieht sie an, die Augen wieder gross und blau. Iurii sagt, dass der Ausbruch des Krieges der bedeutendste Moment in seinem Leben gewesen sei. Umso mehr für Tetiana. Sie habe sich als Person entwickelt und sei stärker geworden. «In schwierigen Zeiten wächst man am meisten. Lange hatte ich das Gefühl, mit meiner Flucht mein Land im Stich zu lassen. Jetzt weiss ich, dass ich auch von hier helfen kann.» Beide sind nun wortlos. Es ist keine unangenehme Stille. Dann stehen Iurii und Tetiana auf und schieben die Stühle zurück an den Tisch. Eine stille Übereinkunft, weiterzumachen.





